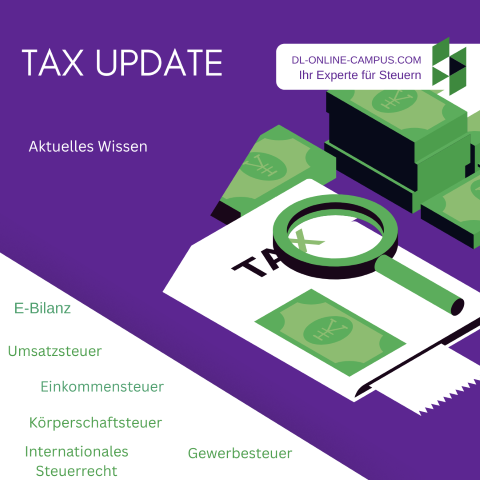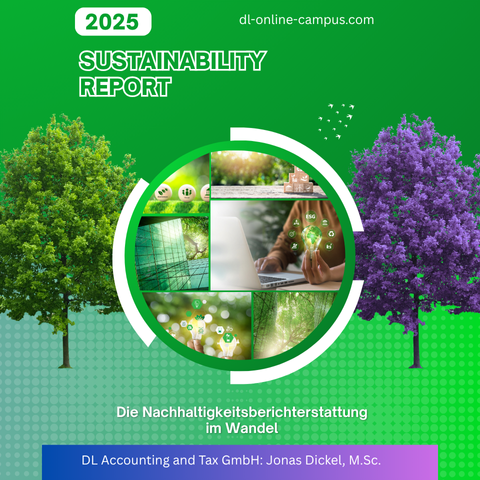-Steueränderungsgesetz 2025-
Bürokratieabbau und Erleichterung für steuerbegünstige Vereine und gemeinnützige GmbH´s
Das Steueränderungsgesetz 2025 mit geplanter Wirkung zum 1.1.2026 steht vor der Tür. Bekannt sind die Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Speisen von Gastronomiebetrieben auf 7% und die Anhebung der Entfernungspauschale zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem ersten Entfernungskilometer auf 0,38€/km.
Das Steueränderungsgesetz 2025 bringt auch erhebliche Erleichterungen für steuerbegünstigte Vereine und insbesondere auch für gemeinnützige GmbH´s. Hervorzuheben sind:
1. Die Anhebung der Übungsleiterpauschale von 3.000 € auf 3.300 €, § 3 Nr.26 EStG
2. Die Anhebung der Ehrenamtspauschale von 840 € auf 960 €.
3. Die Einführung von eSport als neuen gemeinnützigen Zweck, § 52 Abs.2 S.1 Nr.21 AO
4.
Ausnahme vom Mittelverwendungsgebot: Anhebung
der Freigrenze von 45.000 € auf 100.000 €,
§ 55 Abs.1 Nr.5 S.4 AO
5. Anhebung der Besteuerungsfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von 45.000 € auf 50.000 €, § 64 Abs.1 S.1 AO
6. Neue Freigrenze für den Verzicht auf Sphärenzuordnung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe und Zweckbetriebe bei Einnahmen unter 50.000 €, § 64 Abs.3 S.2 AO
7. Photovoltaikanlagen als steuerlich unschädliche Betätigung, § 58 Nr.11 AO
Im nachfolgenden Teil finden Sie die Details zu den einzelnen Regelungen:
1. Anhebung der Übungsleiterpauschale von 3.000 € auf 3.300 €, § 3 Nr.26 EStG
Der Gesetzgeber beabsichtigt eine Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Nebenberufliche Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher genießen ab 1.1.2026 einen höheren Freibetrag von 3.300 €. Das bedeutet, dass bis zu dieser Höhe keine Einkommensteuer und keine Sozialabgaben anfallen. Ausgaben in dieser Höhe bleiben unberücksichtigt, § 3c Abs.1 EStG.
2. Anhebung der Ehrenamtspauschale von 840 € auf 960 €, § 3 Nr.26a EStG
Personen, welche für den gemeinnützigen Verein tätig sein, z.B. Vorstände oder Mitglieder, welche Trikots reinigen und ein Entgelt erhalten, werden durch die Ehrenamtspauschale begünstigt. Ab 1.1.2026 erhöht sich der Freibetrag auf 960 €. Bis zu dieser Höhe fallen keine Einkommensteuer und keine Sozialabgaben an.
3. Einführung des eSports als gemeinnütziger Zweck, 52 Abs.2 S.1 Nr.21 AO
Bei Neugründung eines Vereins prüft der Steuerberater die Zwecke des Vereins. Eine steuerliche Förderung ist nur möglich, wenn der Verein gemeinnützige Zwecke, mildtätige Zwecke oder kirchliche Zwecke verfolgt. § 52 Abs.1 AO enthält eine Auflistung der Zwecke, die der Gesetzgeber für förderungswürdig hält. Begünstigt ist jetzt auch der eSport. Ausgeschlossen sind allerdings rohe Gewalt, die realitätsnah simuliert wird. Darüber hinaus werden Spiel nicht gefördert, mit denen man Geld verdienen kann.
4.
Ausnahme vom
Mittelverwendungsgebot: Anhebung der Freigrenze von 45.000 € auf 100.000 €,
§ 55 Abs.1 Nr.5 S.4 AO
Steuerbegünstige Vereine sowie andere steuerbegünstige Körperschaften müssen ihre erzielten Mittel grundsätzlich zeitnah für satzungsmäßige Zwecke ausgeben. Die aktuelle Frist für die Ausgabe der Mittel liegt bei zwei Jahren (Folgejahre nach dem Zufluss), § 55 Abs.1 Nr.5 AO. Für kleine Vereine gilt eine Ausnahme. Betragen die jährlichen Einnahmen unter 45.000 €, entfällt die Verpflichtung zur zeitnahen Mittelverwendung. Durch das Steueränderungsgesetz 2025 wird diese Grenze auf 100.000 € angehoben. Damit wird der Kreis der Vereine, welche diese Erleichterung nutzen können, erheblich erweitert. Nach dem BMF-Schreiben vom 6.8.2021, AEAO § 55 Nr.30 gehören zu den Einnahmen sämtliche nach § 11 EStG zugeflossenen Vermögensmehrungen. Abgestellt wird auf eine „cash-flow orientierte Betrachtungsweise“. Erfasst werden müssen die Einnahmen aus den vier Vereinsbereichen, dem ideellen Bereich, dem Zweckbetrieb, der Vermögensverwaltung und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, um zu prüfen, ob die Grenze von 100.000 € nicht überschritten ist.
5.
Anhebung der
Besteuerungsfreigrenze für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe von 45.000 € auf
50.000 €, § 64 Abs.1 S.1 AO
Gemeinnützige Vereine dürfen
neben der Erfüllung ihrer Satzungszwecke wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
unterhalten. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt vor, wenn der Verein
Tätigkeiten mit Einnahmeerzielungsabsicht durchführt und keine
Zweckbetriebseigenschaft vorliegt,
§ 14 AO. Dazu gehört z.B. der Verkauf von Speisen und Getränken bei einem
Sportverein oder Einnahmen aus Sponsoring aus Lautsprecherdurchsagen
(Werbezwecke) bei einer Veranstaltung. Bisher waren die Gewinne aus
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ertragssteuerfrei, wenn die
Besteuerungsgrenze in Höhe von 45.000 €, bezogen auf den Bruttoumsatz, nicht
überschritten wurde. Das Steueränderungsgesetz
2025 hebt die jährliche
Besteuerungsfreigrenze auf 50.000 € an.
Keine Veränderung ergibt sich für die Prüfung der Freigrenze. Hier ist
weiterhin der Bruttoumsatz aus sämtlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben
eines Jahres maßgeblich. Die Besteuerungsfreigrenze ist für die
Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer anzuwenden.
6. Neue Freigrenze für den Verzicht auf Sphärenzuordnung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe und Zweckbetriebe bei Einnahmen unter 50.000 €, § 64 Abs.3 S.2 AO
In der Praxis treten häufig Probleme im Rahmen der Abgrenzung zwischen einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und einem ertragssteuerfreien Zweckbetrieb auf. Zusätzlich ist die Abgrenzung für den Umsatzsteuersatz eines umsatzsteuerpflichtigen Vorgangs relevant. Für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe greift grundsätzlich der Regelumsatzsteuersatz von 19%, für Zweckbetriebe der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%. Ausnahmen wurden vernachlässigt.
Liegen die Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben unter 50.000 €, muss nach dieser Neuregelung keine Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben auf diese beiden Bereiche erfolgen. Diese Regelung soll dem Bürokratieabbau dienen. Die Höhe von 50.000 € ergibt sich aus der Anhebung der Besteuerungsfreigrenze bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben auf den identischen Betrag und kann als systemgerecht qualifiziert werden.
7. Photovoltaikanlagen als steuerlich unschädliche Betätigung, § 58 Nr.11 AO
§ 58 AO enthält eine Liste mit steuerlich unschädlichen Vorgängen. Das Steueränderungsgesetz 2025 ergänzt diese Liste um den Betrieb einer Photovoltaikanlage. Diese Tätigkeit führt nicht zu einer Fehlverwendung von Mitteln.
Mit unserem Blog können Sie sich auf dem Laufenden halten: Accounting-Taxation-Themen. Wissensvorsprung nutzen.
Autor: ©Prof. Dr. Monique Reis, StB
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der DL Accounting and Tax GmbH, Prof. Dr. Monique Reis, StB ist die Vervielfältigung der Inhalte oder Teile daraus nicht gestattet. Das gilt auch für das Recht der öffentlichen Wiedergabe.
DL Accounting and Tax GmbH
Prof. Dr. Monique Reis, Steuerberaterin
dl-online-campus.com
Autor: Prof. Dr. Monique Reis, StB
-Steuerliches Investitionssofortprogramm am 11.07.2025 verabschiedet -
Hintergrund des Investitionssofortprogrammes, "Booster":
Der Bundesrat hat am 11.07.2025 mit der Drucksache 281/25 dem steuerlichen Investitionssofortprogramm zugestimmt. Die Neuregeln haben zum Ziel, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und eine internationale Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Die zeitliche Anwendung der steuerlichen Förderung hängt von der jeweiligen Regelung ab, welche nachfolgend erläutert wird.
Einführung der degressiven Afa, § 7a Abs.2 EStG n.F.:
Die Wiedereinführung der degressiven Afa für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist nichts Neues. In der Vergangenheit wurde das Instrument einer erhöhten Abschreibung zu Beginn der Nutzung des Wirtschaftsguts mehrfach für steuerpolitische Zwecke genutzt.
Voraussetzung ist, dass ein Unternehmen bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens kauft oder selbst herstellt. Das Wirtschaftsgut muss langfristig genutzt werden und beweglich sein. Sind transportable Sachen nicht fest mit einem unbeweglichen Wirtschaftsgut verbunden, ist das Kriterium der "Beweglichkeit" erfüllt. Begünstigt sind z.B. in der Praxis:
-
Büroeinrichtung
-
Werkzeuge
-
Maschinen
-
Kraftfahrzeuge
Keine degressive Afa ist bei Gebäuden oder immateriellen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens möglich, da in beiden Fällen "Unbeweglichkeit" vorliegt. Ausgeschlossen sind auch Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens, wie z.B. Vorräte, da planmäßige Abschreibungen im Umlaufvermögen ausgeschlossen sind.
Liegt ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens vor, ist der Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zu prüfen. Die degressive Afa darf nur genutzt werden, wenn das Wirtschaftsgut nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028 angeschafft oder hergestellt wurde. Offensichtlich hat der Gesetzgeber einen befristeten Zeitraum gewählt, um zeitnahe Investitionsanreize auszulösen. Bei unterjähriger Anschaffung oder Herstellung ist die degressive Afa monatsweise zu berechnen, § 7 Abs.2 S.3 EStG.
Die Höhe der degressiven Afa beträgt maximal 30%, maximal das Dreifache des linearen Afa-satzes. Es handelt sich um zwei Obergrenzen, die beide zu beachten sind. Beträgt z.B. die Nutzungsdauer laut Afa-tabelle sechs Jahre, ergibt das Dreifache des linearen Afa-satzes 50%. Folglich dürfen nur maximal 30% angesetzt werden.
Unternehmen können an Stelle der linearen Afa die degressive Afa wählen, um einen höheren Betriebsausgabenabzug in den Erstjahren der Investition zu erreichen. Ab dem Zeitpunkt, an dem die lineare Abschreibung (Restbuchwert: Restnutzungsdauer) die degressive Afa übersteigt, führt ein Wechsel der Abschreibungsmethode zu einem höheren Betriebsausgabenabzug und am Ende der Nutzungsdauer zu einem Restbuchwert von 0 bzw. einem Euro.
Die Einführung der degressiven Afa in der Steuerbilanz bzw. der vereinfachten steuerlichen Gewinnermittlung hat keine Auswirkung auf den HGB bzw. IFRS-Abschluss. Aufgrund der tatsächlichen Darstellung der Ertragslage sind bei beiden Rechnungslegungssystemen die planmäßigen Abschreibungen nach der geschätzten betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen, § 253 Abs.3, S.2 HGB und IAS 16.50.
Steuerliche Förderung der Anschaffung eines Elektroautos
Der Gesetzgeber möchte mit § 7 Abs.2a EStG den Absatz von Elektroautos fördern. Sind die Voraussetzungen erfüllt, können Unternehmen die Elektroautos, welche zum Anlagevermögen gehören, erhöht abschreiben und den steuerlichen Gewinn mindern.
Die Voraussetzungen für diese Steuersubvention sind:
-
Elektrofahrzeuge nach § 9 Abs.2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Dazu gehören nicht nur Personenkraftwägen, sondern auch Busse, Lieferwägen oder LKW. Nicht gefördert werden Plug in Hybrid-Fahrzeuge.
-
Anschaffung nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 1. Januar 2028
-
Keine weitere Nutzung einer Sonderabschreibung, z.B. nach § 7g EStG
Die Unternehmen können folgende Abschreibungssätze auf Basis der Anschaffungskosten geltend machen:
Im Jahr der Anschaffung: 75% der Anschaffungskosten
Im ersten Folgejahr der Anschaffung: 10% der Anschaffungskosten
Im zweiten Folgejahr der Anschaffung: 5% der Anschaffungskosten
Im dritten Folgejahr der Anschaffung: 5% der Anschaffungskosten
Im vierten Folgejahr der Anschaffung: 3% der Anschaffungskosten
Im fünften Folgejahr der Anschaffung: 2% der Anschaffungskosten
________________________
Abschreibungen kumuliert über 5 Jahre: 100%
Die Abschreibungssätze unterstellen eine Nutzungsdauer von sechs Jahren. Besonders interessant ist die Höhe der Abschreibung im Jahr der Anschaffung. Üben die Unternehmen das Wahlrecht für diese Abschreibung aus, mindert sich der Gewinn im ersten Jahr mit 75% der Anschaffungskosten. Zu beachten ist, dass bei unterjährigem Erwerb nicht monatsweise abzuschreiben ist, sondern der volle Betrag anzusetzen ist, § 7 Abs.2a letzter Satz EStG. Dies wirkt sich bei Personenunternehmen erheblich auf die individuelle Einkommensteuer (ggf. auch den Solidaritätszuschlag) sowie die Gewerbesteuer aus. Bei Kapitalgesellschaften analog auf die Körperschaftsteuer, den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer. Damit verbunden ist ein Liquiditätsvorteil und ein Steuerstundungseffekt, welcher allerdings in den weiteren Jahren durch die niedrigere Abschreibung kompensiert wird.
Privatnutzung von Elektroautos und Dienstwägen
Nutzt ein Einzelunternehmer oder ein Gesellschafter einer Personengesellschaft ein Elektroauto, muss einkommensteuerlich eine Entnahme angesetzt werden, § 6 Abs.1 Nr.4 EStG. Für die Berechnung der Entnahme nach der "Ein-Prozent-Regelung" ist der Brutto-Listenpreis bei Elektroautos nur mit 25% anzusetzen. Bisher konnte dieser Vorteil nur genutzt werden, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs unter 70.000 € lag. Dieser Betrag wird auf 100.000 € erhöht, § 6 Abs.1 Nr.4 S.2 EStG. Die Änderung ist erstmals für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2025 erworben wurden,
§ 52 Abs.12 EStG.
Die Listenpreisregelung inkl. der eben dargestellten Neuregelung ist analog für die Berechnung des geldwerten Vorteils bei Elektroautos anzuwenden, die als Dienstwägen genutzt werden, § 8 Abs.2 S.2 EStG.
Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG auf Antrag
-Änderung des Einkommensteuersatzes für nicht entnommene Gewinne-
§ 34a EStG sieht für Personenunternehmen eine Tarifbegünstigung vor, wenn Gewinn im Unternehmen gelassen werden. Mit dieser Regelung wird erreicht, dass die Gesellschafter eines Personenunternehmens analog zu Kapitalgesellschaften im Thesaurierungsfall eine niedrigere Einkommensteuerbelastung haben.
Ein Antrag für die Thesaurierungsbegünstigung setzt voraus, dass eine Gewinneinkunftsart vorliegt. D.h. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit. Bei Mitunternehmerschaften ist es erforderlich, dass der einzelne Mitunternehmer mit mehr als 10% beteiligt ist und der Gewinnanteil mehr als 10.000 € beträgt, § 34a Abs.1 S.4 EStG.
Der nicht entnommene Gewinn, d.h. der tarifbegünstigte Gewinn, ermittelt sich wie folgt:
Gewinn nach § 4 Abs.1 oder § 5 Abs.1 EStG
-Entnahmen
+Einlagen
+Gewerbesteuer
___________________________________
Nicht entnommene Gewinn nach § 34a Abs.2 EStG
Bisher betrug die Tarifbegünstigung für den nicht entnommenen Gewinn 28,25% zuzüglich Solidaritätszuschlag. Das Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm sieht eine weitere Reduzierung des Einkommensteuersatzes vor. Im Ergebnis soll durch die Absenkung des Thesaurierungssatzes ein "Gleichlauf" zu den fallenden Körperschaftsteuersätzen in der Zukunft erreicht werden.
Die Thesaurierungssätze ohne Solidaritätszuschlag nach § 34a EStG sehen wie folgt aus, § 34a Abs.1 S.1 EStG n.F.:
Bis Veranlagungszeitraum 2007: 28,25%
Bis Veranlagungszeiträume 2028 und 2029: 27%
Bis Veranlagungszeiträume 2030 und 2031: 26%
Ab Veranlagungszeitraum 2032: 25%
An der Nachversteuerungsregel hat sich nichts geändert. Der nachversteuerungspflichtige Betrag ist jährlich gesondert festzustellen, § 34a Abs.3 EStG. Im Falle einer Entnahme des nachversteuerungspflichtigen Betrags erwartet den Steuerpflichtigen eine Nachversteuerungsbelastung von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag, § 34a Abs.4 EStG.
Absenkung des Körperschaftsteuersatzes
Die Ertragsteuerbelastung von Kapitalgesellschaften mit Sitz in Deutschland ist im Thesaurierungsfall mit ca. 30% zu hoch. Das steuerliche Investitionssofortprogramm reduziert die Körperschaftsteuersätze in der Zukunft. Die Absenkung des Körperschaftsteuersatzes erfolgt in fünf Schritten , § 23 Abs.1 KStG n.F.:
Bis Veranlagungszeitraum 2027: 15 Prozent
Veranlagungszeitraum 2028: 14 Prozent
Veranlagungszeitraum 2029: 13 Prozent
Veranlagungszeitraum 2030: 12 Prozent
Veranlagungszeitraum 2031: 11 Prozent
Veranlagungszeitraum ab 2032: 10 Prozent
Der Solidaritätszuschlag mit 5,5% auf die Körperschaftsteuer bleibt aktuell bestehen. An der Gewerbesteuerbelastung hat sich nichts geändert. Ab 2032 sinkt die Ertragsteuerbelastung (KSt, Soli, GewSt) im Thesaurierungsfall bei einem durchschnittlichen Hebesatz von 400% auf ca. 25%.
Forschungszulagengesetz: Erweiterung der Bemessungsgrundlage
Das Forschungszulagengesetz stellt einen Anreiz für Unternehmen dar, Forschung zu betreiben. Dabei kann es sich um Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung handeln.
Unternehmen, welche die Forschungszulage erhalten möchten, müssen zunächst einen Antrag bei der "Bescheinigungsstelle Forschungszulage" (BSFZ) stellen. Diese Stelle prüft, ob das Forschungsvorhaben förderungswürdig ist. Nach positivem Bescheid erfolgt im Anschluss ein Antrag beim Finanzamt. Die Zulage wird nicht sofort ausgezahlt, sondern von der Körperschaftsteuerschuld oder Einkommensteuerschuld abgezogen. Ist die Forschungszulage höher als die Steuerschuld, erfolgt eine Auszahlung des Finanzamts in Höhe des Differenzbetrags. Die Forschungszulage ist steuerfrei.
Die Bemessungsgrundlage der förderfähigen Ausgaben wurde durch das Investitionssofortprogramm erweitert. Zur Bemessungsgrundlage gehören nicht nur die Arbeitslöhne, die Eigenleistung eines Einzelunternehmes, innovative Ausgaben, sondern jetzt auch zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten, welche nach dem 31.12.2025 entstanden sind. Diese werden pauschalisiert mit 20% der förderfähigen Aufwendungen angesetzt.
Die Forschungszulage beträgt 25% der förderfähigen Aufwendungen. Der maximale Betrag der förderfähigen Aufwendungen wurde auf 12 Mio € erhöht (nach dem 31.12.2025), § 3 Abs.5 Forschungszulagengesetz.
Mit unserem Blog können Sie sich auf dem Laufenden halten: Accounting-Taxation-Themen. Wissensvorsprung nutzen.
Autor: ©Prof. Dr. Monique Reis, StB
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der DL Accounting and Tax GmbH, Prof. Dr. Monique Reis, StB ist die Vervielfältigung der Inhalte oder Teile daraus nicht gestattet. Das gilt auch für das Recht der öffentlichen Wiedergabe.
DL Accounting and Tax GmbH
Prof. Dr. Monique Reis, Steuerberaterin
dl-online-campus.com
Autor: Prof. Dr. Monique Reis, StB
-Die Neuregelung des IFRS 18 ersetzt IAS 1 -
IFRS 18: Darstellung und Offenlegung in IFRS-Abschlüssen
Zweck des neuen IFRS 18:
Bisher ist die Darstellung und Offenlegung in IFRS-Abschlüssen in IAS 1 geregelt. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Kategorien zu bilden. Als Salden werden in der Praxis lediglich das Bruttoergebnis nach dem Umsatzkostenverfahren, das Betriebsergebnis, das Finanzergebnis, das Ergebnis vor Steuern und das Ergebnis nach Steuern angegeben. Die fehlende Kategorisierung hat zur Folge, dass das Betriebsergebnis von jedem Unternehmen unterschiedlich berechnet und dargestellt wird. Der neue IFRS 18 dient deshalb der Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Die Bildung der Salden in der GuV wird genau vorgeschrieben. Im Anhang sind weitere Informationen zu den Zwischensalden und dem Gesamtsaldo offenzulegen. Zusätzlich müssen die von der Unternehmensleitung definierten Leistungskennzahlen, die so genannten „Management defined Performance measures“ angegeben werden. IFRS 18 ersetzt den bisherigen IAS 1. Das IASB erhofft sich, dass durch die Neuregelung eine transparentere Darstellung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Unternehmen erfolgt. Die Bilanzleser erhalten zusätzliche entscheidungsnützliche Informationen („decision usefulness“).
Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zur Internationalen Rechnungslegung nach IFRS. Wir bieten seit Jahren den IFRS-Basislehrgang und den IFRS-Expertenlehrgang mit zertifizierter Prüfung an. Details zum neuen IFRS 18 werden detailliert besprochen.
Verschaffen Sie sich einen Eindruck in unserem kostenlosen Demokurs:
Wann ist der neue IFRS 18 anzuwenden?
Der neue IFRS 18 ist erstmalig für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2027 beginnen, anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Das Endorsement für den IFRS 18 steht noch aus. Allerdings hat die EFRAG (European Financial Advisory Group) am 5. Mai 2025 eine Übernahmeempfehlung an die EU-Kommission abgegeben, so dass davon auszugehen ist, dass der Standard in der EU anzuwenden ist (https://www.drsc.de/projekte/indossierung-ifrs18/).
Wer ist vom neuen IFRS 18 betroffen?
Sämtliche Branchen müssen den IFRS 18 anwenden und zwar unabhängig davon, ob ein IFRS-Einzelabschluss oder ein IFRS-Konzernabschluss zu erstellen ist. Für spezielle Branchen, wie zum Beispiel Banken, sieht der Standard teilweise gesonderte Regeln, insbesondere für die Zuordnung zu den Kategorien vor, IFRS 18.49, 50.
Übernimmt IFRS 18 Inhalte aus dem IAS 1?
IFRS 18 übernimmt für die einzelnen Abschlussbestandteile Regeln aus dem IAS 1.
Bilanz:
Die Bilanz ist weiterhin nach der Fristigkeit oder im Ausnahmefall nach der Liquidität zu gliedern. Die Fristigkeitsmerkmale werden im Wesentlichen übernommen. Der Bilanzleser muss erkennen können, ob ein Vermögenswert oder eine Schuld innerhalb von 12 Monaten (kurzfristig) oder nach 12 Monaten (langfristig) realisiert wird. Die Fristigkeitsangabe spielt für zahlreiche bilanzanalytische Kennzahlen eine Rolle. Weiterhin sieht IFRS 18 analog zu IAS 1 lediglich ein Mindestpostengliederungsschema vor. Das Unternehmen nutzt die Möglichkeit in der Praxis, die entsprechenden Mindestposten in geeignete Unterposten zu untergliedern. Die Unterposten müssen zutreffend bezeichnet werden. Die Mindestposten nach IFRS 18 wurden geringfügig, z.B. um die Neuregelung zu IFRS 17, angepasst.
Eigenkapitalveränderungsrechnung:
Der IFRS-Anwender muss neben der Bilanz eine Eigenkapitalveränderungsrechnung aufzustellen, IFRS 18.107. Das Eigenkapital ist zu Beginn der Berichtsperiode in die Eigenkapitalkomponenten zu gliedern. Die Veränderung des Eigenkapitals ist aufzuzeigen. Dazu gehören retrospektive Anpassungen nach IAS 8, Gewinn oder Verlust der Berichtsperiode, Veränderung des Eigenkapitals durch die Neubewertungsrücklage sowie durch Transaktionen mit Anteilseignern (Kapitalerhöhungen, Kapitalherabsetzungen, Dividendenausschüttungen).
Kapitalflussrechnung:
Die Kapitalflussrechnung ist weiterhin in IAS 7 geregelt. Allerdings sind für die Kapitalflussrechnung auch allgemeine Regeln aus IFRS 18 zu beachten, IFRS 18.3, da die Kapitalflussrechnung zu einem vollständigen IFRS-Abschluss gehört.
Gesamtergebnisrechnung:
IFRS 18 übernimmt die grundsätzliche Struktur der Gesamtergebnisrechnung aus dem IAS 1. Die Gesamtergebnisrechnung ist in die zwei bekannten „Töpfe“, die Gewinn- und Verlustrechnung (profit or loss) und das sonstige Ergebnis (other comprehensive) zu gliedern, IFRS 18.86. Im Konzernabschluss muss der Gewinn/Verlust bzw. das sonstige Ergebnis auf die Muttergesellschaft und die nichtkontrollierenden Gesellschafter aufgeteilt werden. Unterschiede zu IAS 1 liegen in den Details vor, welche im Anschluss erläutert werden.
Welche Kategorien, Zwischensalden bzw. Endsalden sind nach IFRS 18 zu bilden?
Im Gegensatz zu IAS 1 schreibt IFRS 18.47 vor, dass fünf Kategorien in der Gewinn- und Verlustrechnung zu bilden sind:
· Operative Kategorie
· Investitionskategorie
· Finanzierungskategorie
· Die Ertragssteuerkategorie
· Die Kategorie von aufgegebenen Geschäftsbereichen
In Abhängigkeit von der Kategorie sind entsprechende Zwischensalden auszuweisen. Innerhalb der Kategorien ist das Saldierungsverbot zu beachten. Erträge und Aufwendungen dürfen nicht saldiert werden, es sei denn ein IFRS-Rechnungslegungsstandard schreibt dies vor oder erlaubt es, IFRS 18.44.
Operative Kategorie
Die operative Kategorie wird durch „Ausschlussverfahren“ definiert. Posten, d.h. Aufwendungen und Erträge gehören zu dieser Kategorie, wenn sie keiner der anderen vier Kategorien zuzuordnen sind, IFRS 18.52. Dazu gehören nach dem Umsatzkostenverfahren die Umsatzerlöse, die Umsatzkosten, die Verwaltungskosten, Vertriebskosten etc.
Investitionskategorie
In dieser Kategorie werden Renditen von eigenständigen Investitionen, die von der Hauptgeschäftstätigkeit zu trennen sind, erfasst. Dazu gehören Erträge und Aufwendungen, IFRS 18.53:
-
Investitionen in assoziierte Unternehmen, Joint Ventures und Tochtergesellschaften, die nicht nach der Equity-Methode zu bilanzieren sind, z.B. im IFRS Einzelabschluss nach IAS 27.10.
-
Investitionen in assoziierte Unternehmen, Joint Ventures und Tochtergesellschaften, die nach der Equity-Methode zu bilanzieren sind, z.B. im IFRS Konzernabschluss nach IAS 28.10.
-
Erträge und Aufwendungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, z.B. Zinserträge.
-
Erträge und Aufwendungen aus anderen Vermögenswerten, die einzeln und weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens eine Rendite erwirtschaften zum Beispiel Zinserträge aus Anleihen, Dividenden und Mieteinnahmen aus investment property.
Die Beträge dieser Kategorie können sich zusammensetzen aus:
-
Mit Vermögenswerten erzielte Erträge, z.B. Dividendenausschüttungen oder Zinserträge.
-
Die Erträge und Aufwendungen aus der Erst- und Folgebewertung der Vermögenswerte einschließlich der Ausbuchung, z.B. die Effektivverzinsung von Anleihen oder die Wertfortschreibung im Rahmen der Equity-Methode.
-
Die zusätzlichen Kosten, die direkt dem Erwerb und der Veräußerung der Vermögenswerte zuzurechnen sind, beispielsweise Transaktionskosten und Kosten für deren Veräußerung.
Zu beachten ist, dass die Investitionskategorie nach IFRS 18 völlig von der Investitionskategorie in der Kapitalflussrechnung abweicht, da die Zielsetzung beider Abschlussbestandteile unterschiedlich ist.
Finanzierungskategorie
Zu dieser Kategorie gehören Aufwendungen und Erträge aus Verbindlichkeiten zu Finanzierungszwecken, z.B. Bankkredite oder Anleiheemissionen. Weiterhin gehören zu dieser Kategorie auch sonstige Verbindlichkeiten, z.B. der Zinsaufwand beim Leasingnehmer oder die Aufzinsung von Rückstellungen, insbesondere auch Pensionsrückstellungen.
Ertragsteuerkategorie
Unter den Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen tatsächliche und latente Steuern und ggf. Währungsumrechnungsdifferenzen, die mit diesem Posten in Zusammenhang stehen.
Kategorie der „aufgegebenen Geschäftsbereiche“
Liegt ein Plan des Managements vor, einen Geschäftsbereich innerhalb der nächsten 12 Monate aufzugeben bzw. wird aktiv ein Käufer gesucht, ist IFRS 5 anzuwenden. Erträge und Aufwendungen, welche auf den aufzugebenden Geschäftsbereich entfallen, sind unter dieser Kategorie auszuweisen.
Aggregation und Disaggregation?
Für sämtliche Kategorien gilt, dass Erträge bzw. Aufwendungen zusammengefasst werden können, wenn sie gemeinsame Merkmale aufweisen. Posten ohne gemeinsame Merkmale sind einer Disaggregation zu unterziehen. Parallel sind zusätzliche wesentliche Informationen im Anhang zu geben, IFRS 18.41. Das bedeutet, dass durch den neuen IFRS 18 die Anhangangaben umfangreicher werden. An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass die Aggregation und Disaggregation in der Bilanz analog anzuwenden ist. Sollte sich ein Unternehmen in der Bilanz dafür entscheiden, Eigen- und Fremdkapitalinstrumente nach IFRS 9 in die Kategorie „Fair value through profit or loss“ einzuordnen, sollte zumindest im Anhang eine Aufsplittung dieser Instrumente erfolgen, da der Charakter der beiden Wertpapiere unterschiedlich ist.
Struktur der neuen Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS – Pflichtsalden
ohne aufzugebende Geschäftsbereiche
Operative Aufwendungen und Erträge
Ergebnis aus der operativen Kategorie
Aufwendungen und Erträge aus der Investitionstätigkeit
Ergebnis aus der Investitionskategorie
Ergebnis vor Finanzierung und Steuern (= EBIT)
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit
Ergebnis aus der Finanzierungskategorie
Steueraufwendungen und Steuererträge
inkl. Währungsumrechnungsdifferenzen
Ertragsteuerkategorie
Ergebnis nach Steuern
Die Erfolgsspaltung stellt sicher, dass die Bilanzadressaten sich schnell über die Erfolgsparameter eines Unternehmens informieren können. Das Betriebsergebnis (operating profit) wird als eigenständige Wertschöpfung betrachtet. Dagegen hängt das Investitionsergebnis bei Eigenkapitalgeberpapieren von der Leistungsfähigkeit des Beteiligungsunternehmens ab. Die Zusammenfassung des Betriebsergebnisses und Investitionsergebnisses stellt ein Zwischensaldo dar. und entspricht dem EBIT (Earnings Before Financing and Taxation). Es folgen die Finanzierungsaufwendungen und Ertragsteuern, um zum Ergebnis nach Steuern zu gelangen.
Sind weitere Kennzahlen nach IFRS 18 anzugeben (Management-defined performance measures)?
IFRS 18 schreibt vor, dass in der Gewinn- und Verlustrechnung keine weiteren Kennzahlen neben den ausgewiesenen Zwischensummen präsentiert werden dürfen. Allerdings müssen im Anhang Leistungskennzahlen, die das Management verwendet, angegeben bzw. erläutert werden. Diese geben dem Bilanzleser Aufschluss, wie das Management die Ertragslage des Unternehmens einschätzt. Eine Berichtspflicht (IFRS 18.117) im Anhang liegt nur vor, wenn
-
die Leistungskennzahlen des Managements in der öffentlichen Kommunikation außerhalb des Abschlusses genutzt werden, z.B. in Pressemitteilungen oder sozialen Netzwerken,
-
nicht in den IFRS Standards geregelt sind
-
die Sicht des Managements widergespiegelt wird.
Zu den MPMs gehören beispielsweise Kennzahlen wie das bereinigte Ergebnis (adjusted profit o floss) oder das bereinigte betriebliche Ergebnis (adjusted operating profit or loss). Die Bereinigung bezieht sich auf die Herausnahme von einmaligen und außergewöhnlichen Faktoren.
Nicht zu den MPMs gehören IFRS-Zwischensalden oder einzelne IFRS-Posten (z.B. Bruttoergebnis), oder weitere Kennzahlen, wie zum Beispiel den Free Cashflow oder nichtmonetäre Leistungskennzahlen.
Mit unserem Blog können Sie sich auf dem Laufenden halten: Accounting-Taxation-Themen. Wissensvorsprung nutzen.
Autor: ©Prof. Dr. Monique Reis, StB
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der DL Accounting and Tax GmbH, Prof. Dr. Monique Reis, StB ist die Vervielfältigung der Inhalte oder Teile daraus nicht gestattet. Das gilt auch für das Recht der öffentlichen Wiedergabe.
DL Accounting and Tax GmbH
Prof. Dr. Monique Reis, Steuerberaterin
dl-online-campus.com
Autor: Prof. Dr. Monique Reis, StB
-Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung -
Weiterhin hohe Dynamik im Regulierungsumfeld der Nachhaltigkeitsberichterstattung:
Nächste Hürde für VSME-Standard: EU-Kommission empfiehlt dessen Anwendung
Am 30. Juli 2025 veröffentlichte die EU-Kommission ihre Empfehlung zur freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit dem Dokument empfiehlt die Kommission ausdrücklich die Anwendung des von EFRAG entwickelten „Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs“ (VSME) für Unternehmen, die freiwillig Nachhaltigkeitsinformationen offenlegen möchten. Ziel der Empfehlung ist es, einheitliche Rahmenbedingungen für freiwillige Berichterstattung zu schaffen und die Marktakzeptanz des VSME sowohl bei Unternehmen als auch bei Informationsnutzern zu fördern.
Mit dieser Empfehlung verfolgt die Kommission mehrere Ziele: Einerseits sollen Unternehmen außerhalb des CSRD-Anwenderkreises dabei unterstützt werden, standardisiert auf Informationsanfragen von Finanzinstitutionen oder großen Geschäftspartnern zu reagieren. Andererseits kann die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung für diese Unternehmen auch den Zugang zu nachhaltiger Finanzierung erleichtern, zur internen Steuerung der Nachhaltigkeitsleistung beitragen und die Resilienz sowie Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Zusätzlich werden auch die Mitgliedstaaten in die Verantwortung genommen: Sie sollen die Vorteile der freiwilligen Anwendung des VSME aktiv kommunizieren, geeignete Maßnahmen zur Umsetzung und Akzeptanz des Standards entwickeln, Unternehmen und Finanzakteure zur Orientierung an den VSME-Vorgaben anhalten und die Digitalisierung zur Vereinfachung des Datenaustauschs vorantreiben.
Der VSME-Standard (Anhang I) sowie die dazugehörigen praktischen Leitlinien (Anhang II) wurden der Empfehlung beigefügt und stehen auf Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung. Besonders erfreulich ist die Anlehnung der deutschen Übersetzung an die Empfehlung des DRSC und der AFRAG (unser Referent Jonas Dickel ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe des DRSC u. AFRAG) Im nächsten Schritt entwickelt die EU-Kommission einen delegierten Rechtsakt, um dem freiwilligen Standard weiteres regulatorisches Gewicht zu verleihen. Dieser kann sich jedoch, abhängig von der endgültigen Ausgestaltung des CSRD-Anwenderkreises, vom jetzigen VSME noch unterscheiden.
Vereinfachung der ESRS für berichtspflichtige Unternehmen: EFRAG veröffentlicht Entwürfe und stellt diese zur Konsultation
Nur einen Tag später, am 31. Juli 2025, veröffentlichte die EFRAG außerdem überarbeitete Entwürfe des ESRS Set 1 und stellte diese zur Konsultation. Die zwölf überarbeiteten Standards (ESRS 1 und 2, ESRS E-1 bis E-5, ESRS S-1 bis S-4 sowie ESRS G-1) sollen durch Klarstellungen und Vereinfachungen die Anwendung der CSRD-Vorgaben für berichtspflichtige Unternehmen erleichtern. Neben den Standardentwürfen wurden auch Änderungsübersichten („log of amendments“), zusätzliche freiwillige Anwendungshinweise („non-mandatory implementation guidance“), ein Glossar sowie eine „Basis for Conclusions“ veröffentlicht. Die öffentliche Konsultationsfrist läuft bis zum 29. September 2025.
Mit der Überarbeitung reagiert EFRAG auf die im Februar 2025 von der EU-Kommission angestoßene Omnibus-Initiative zur Entlastung von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese Initiative sah unter anderem die Vereinfachung der im Januar 2024 in Kraft getretenen ESRS Set 1 vor (Delegierte Verordnung (EU) 2023/2772). Im März 2025 wurde EFRAG beauftragt, eine fachliche Empfehlung zur Revision zu erarbeiten, wobei die ursprünglich gesetzte Frist bis Oktober 2025 später auf den 30. November 2025 verlängert wurde.
Die nun vorgelegten Änderungen umfassen eine Reduktion der verpflichtend zu berichtenden Datenpunkte um 57 % sowie eine Kürzung des Gesamtumfangs der Standards um 55 % . Ziel ist es, die Wesentlichkeit als zentrales Prinzip stärker zu verankern und damit eine checklistenartige Berichterstattung zu vermeiden.
Autor: ©Jonas Dickel, M.Sc.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der DL Accounting and Tax GmbH, Prof. Dr. Monique Reis, StB ist die Vervielfältigung der Inhalte oder Teile daraus nicht gestattet. Das gilt auch für das Recht der öffentlichen Wiedergabe.